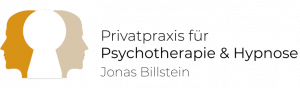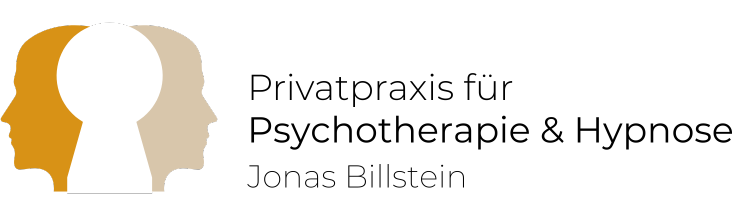Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. In der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie werden sie nicht nur als isoliertes Symptom verstanden, sondern als Ausdruck innerer Konflikte, die dem bewussten Erleben oft nur teilweise zugänglich sind.
Dieser Artikel zeigt anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis,
wie Angst aus tiefenpsychologischer Sicht entsteht –
und warum sie häufig eine schutzvolle Funktion erfüllt.
Symptome als Ausdruck innerer Konflikte
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist ein psychodynamisches Verfahren. Sie ist aus der Psychoanalyse hervorgegangen und betrachtet psychische Symptome als Ausdruck tieferliegender, teilweise unbewusster Prozesse.
Im Unterschied zur klassischen Psychoanalyse orientiert sich die Tiefenpsychologie jedoch stärker an den aktuellen Beschwerden und Lebensproblemen der Patientinnen und Patienten. Ziel ist es, psychische Symptome in einem überschaubaren Zeitraum zu lindern, ohne dabei den Blick für ihre Ursachen zu verlieren.
Innerhalb der Tiefenpsychologie existieren verschiedene theoretische Strömungen. Gemeinsam ist ihnen die Annahme, dass unbewusste innere Dynamiken einen wesentlichen Einfluss auf das psychische Erleben haben – auch wenn diese nicht direkt beobachtbar sind.
Menschliche Grundbefüfnisse
Ursprünglich verstand Sigmund Freud unter unbewussten Konflikten vor allem Spannungen zwischen Trieben, Ich und Über-Ich. Dieses klassische Triebmodell wurde im Laufe der Zeit erweitert.
Insbesondere durch die Bindungsforschung und die Objektbeziehungs- und Selbstpsychologie verlagerte sich der Fokus:
Nicht mehr allein Triebbefriedigung, sondern die Qualität früher Beziehungen und die Befriedigung zentraler psychischer Grundbedürfnisse rückten in den Mittelpunkt.
Einen wichtigen Impuls lieferte dabei die Bindungstheorie von John Bowlby, ohne jedoch andere psychodynamische Konzepte zu ersetzen.
In der Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) wird davon ausgegangen, dass psychische Konflikte häufig dann entstehen, wenn zentrale Bedürfnisse früh, dauerhaft oder massiv frustriert werden.
Zu diesen Grundbedürfnissen zählen
Bindung
Kontrolle und Sicherheit
Versorgung und Fürsorge
Anerkennung und Wertschätzung
Soziale Kooperation und Verantwortlichkeit
Körperlich-sinnliche Nähe und Sexualität
Identität
Diese Bedürfnisse gelten als angelegt und entwicklungsleitend. Werden sie nicht ausreichend befriedigt, kann sich die psychische Entwicklung einseitig organisieren – mit möglichen Folgen für das spätere Erleben und Verhalten.
Autonomie vs. Individualität
Die Patientin stellte sich mit der Diagnose einer generalisierten Angststörung und gelegentlichen Panikattacken in der Praxis vor. In der Anamnese zeigte sich ein Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt mit deutlicher Tendenz zur Autonomie.
Sie:
mied enge Bindungen,
fühlte sich schnell eingeengt,
lebte bis vor einigen Jahren stabil, funktional und selbstbestimmt.
Menschen bei denen dieser Konflikt stärker ausgeprägt ist, meiden teilweise jede zwischenmenschliche Beziehung bis hin zur sozialen Isolation. Die Patientin hatte bis zum Beginn der Symptome Wert auf ein unabhängiges Leben gelegt, war aber ansonsten gut in ihr soziales Umfeld eingebunden.
Geburt des Kindes als Auslöser
Die Situation veränderte sich mit einer ungeplanten Schwangerschaft und der Geburt ihres Kindes. Die enge und unvermeidbare Bindung zwischen Mutter und Kind kollidierte erstmals massiv mit ihrem bisherigen inneren Gleichgewicht.
Die Patientin liebte ihr Kind –
und erlebte gleichzeitig Gefühle von Enge, Wut und Abwehr.
Diese Ambivalenz war für sie kaum erträglich. Sie begann, die negativen Gefühle zu verdrängen, entwickelte Schuld- und Schamgefühle – und zunehmend Angst.
Abwehrmechanismen
Verdrängung bedeutet nicht, dass etwas verschwindet. Abgewehrte Inhalte bleiben psychisch wirksam, sind jedoch der bewussten Kontrolle entzogen.
Zusätzlich entwickelte sich eine Reaktionsbildung:
Die verdrängten negativen Gefühle wurden auf der bewussten Ebene in ihr Gegenteil verkehrt. Die Patientin wurde übermäßig fürsorglich, selbstaufopfernd und idealisierend.
Damit war der innere Konflikt scheinbar gelöst. Tatsächlich wurde er vom Bewusstsein abgespalten – und genau das führte zur Entstehung von Angst.
Die Angst war zunächst an bestimmte innere Impulse gebunden, wurde später jedoch frei flottierend. Sie äußerte sich in innerer Unruhe, Schlafstörungen und einer diffusen Ängstlichkeit.
Tiefenpsychologische Therapie: Angst verstehen statt bekämpfen
In der Therapie ging es nicht darum, die Angst direkt zu bekämpfen, sondern ihre Funktion zu verstehen. Schrittweise konnte die Patientin lernen, ihre ambivalenten Gefühle gegenüber ihrem Kind anzunehmen, ohne sich dafür moralisch zu verurteilen.
Mit der Integration dieser Gefühle verlor die Angst ihre Schutzfunktion – und verschwand.
Der zugrunde liegende Konflikt blieb bestehen, musste jedoch nicht vollständig aufgelöst werden. Ziel war nicht Konfliktfreiheit, sondern ein flexiblerer, reiferer Umgang mit inneren Spannungen.
Fazit: Angst als Signal innerer Prozesse
Aus tiefenpsychologischer Sicht ist Angst häufig kein Feind, sondern ein Hinweis darauf, dass innerlich etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Werden diese Signale verstanden und integriert, kann nachhaltige Veränderung möglich werden.
In meiner psychotherapeutischen Arbeit in Köln kombiniere ich tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie mit therapeutischer Hypnose, um auch unbewusste Prozesse behutsam zugänglich zu machen – insbesondere bei Angststörungen, innerer Unruhe und psychosomatischen Beschwerden.